Forschung und Neuerscheinungen
Hier werden die Forschungsprojekte sowie Publikationen an denen Mitarbeiter:innen der Abteilung beteiligt sind vorgestellt.
Im Folgenden werden die Forschungsprojekte der Bonner Medienwissenschaft vorgestellt.
- Dr. Felix Hüttemann und Prof. Dr. Jens Schröter: „The Computerized Palate. Digital Technologies and The Lower Senses.”, VW-Stiftung, Programmlinie Aufbruch (ab 1.4.2025)
- Prof. Dr. Kathrin Friedrich: "Precision Farming: Ko-operative Praktiken des Virtual Vencing" im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Medien der Kooperation (Universität Siegen) (ab 01/2024).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "Generative AI and the Digital Society – Acceptance and Usage in Selected Contexts", Deutsche Telekom AG, Laufzeit: ein Jahr (ab 01/2024).
- Prof. Dr. Kathrin Friedrich: Teilprojekt Medienwissenschaft im Projektverbund "InVirtuo 4.0: Experimentelle Forschung in virtuellen Umgebungen", Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Technische Universität Dortmund, Deutsches Zentrum für Neurogenerative Erkrankungen e. V. (DZNE), Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW NRW). Pressemitteilung, Laufzeit: drei Jahre (ab 11/2023).
- Prof. Dr. Kathrin Friedrich (zusammen mit Jun.-Prof. Dr. Moritz Queisner, Charité Universitätsmedizin Berlin): "4D Imaging: Von der Bildtheorie zur Bildpraxis" im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Das digitale Bild", Projektbeschreibung. Laufzeit: drei Jahre (ab 03/2023).
- Dr. Dr. Stefan Höltgen (assoziiert mit Lehrstuhl Prof. Dr. Jens Schröter): "Computerphilologie: Technische Lektüren der BASIC-Programmierkultur", DFG, Laufzeit drei Jahre (ab 10/2022).
- Prof. Dr. Jens Schröter (mit Prof. Dr. Anna Echterhölter, Prof. Dr. Alexander Waibel, PD Dr. Andreas Sudmann): "How is Artificial Intelligence Changing Science? Research in the Era of Learning Algorithms", VW Stiftung Full Grant. Laufzeit: vier Jahre (ab 08/2022).
- PD Dr. Christoph Ernst: "Szenarien der Interaktion – Mensch-Maschine-Interfaces in der Diskussion um AWS", Teilprojekt im Rahmen des BMBF-Kompetenznetzwerks "Meaningful Human Control – Autonome Waffensysteme zwischen Regulation und Reflexion", Laufzeit: vier Jahre (ab 04/2022).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "Autonomie und Autonome Systeme", TRA 4, Laufzeit: vier Jahre (ab 01/2021).
- Prof. Dr. Schröter (mit Prof. Dr. Gabriele Gramelsberger, Dr. Stefan Meretz, Dr. Hanno Pahl, Dr. Manuel Scholz) "Die Gesellschaft nach dem Geld. Eine Simulation", VW Stiftung: Full Grant, Laufzeit: vier Jahre (ab 10/2018, kostenneutrale Laufzeitverlängerung bis 12/2024).
- Prof. Dr. Britta Hartmann (mit Dr. Tobias Ebbrecht-Hartmann, Hebrew University of Jerusalem): "TikTok Activism and Identity Struggles in Entangled Jewish, Israeli, Palestinian, Arab, and German Contexts: Modes of Address, Aesthetics, and Rhetorics of Affects (im Rahmen der Ausschreibung "Collaborative Research Grants"), Laufzeit: zwei Jahre (2022-2024).
- Prof. Dr. Britta Hartmann (mit Prof. Dr. Jens Eder, Dr. Chris Tedjasukmana): "Aufmerksamkeitsstrategien des Videoaktivismus im Social Web", VW-Stiftung (2018-2023).
- PD Dr. Christoph Ernst, Prof. Dr. Jens Schröter: "Informations- und Datenvisualisierungen der Corona-Pandemie", TRA 4 (2022).
- Prof. Dr. Caja Thimm (mit Prof. Dr. Christoph Bieber): Teilprojekt im Graduiertenkolleg an der Universität Bonn "Digitale Gesellschaft": "Ethik und Verantwortung in der digitalen Gesellschaft: Datenpraktiken in Verwaltung und und Journalismus", MKW NRW (2018-2022).
- Prof. Dr. Caja Thimm (zusammen mit Patrick Nehls, MA, Yannik Peters, MA): "Plattformöffentlichkeit(en) in der Pandemie: Informations- und Desinformationsdiskurse auf Instagram", TRA 4 (2022).
- Prof. Dr. Caja Thimm "Friendly AI", Deutsche Telekom AG (2021-2022).
- Prof. Dr. Jens Schröter (mit Prof. Dr. Anna Echterhölter, Prof. Dr. Alexander Waibel, PD Dr. Andreas Sudmann): "How is Artificial Intelligence Changing Science? Research in the Era of Learning Algorithms", VW Stiftung Planning Grant (2020-2021).
- Prof. Dr. Jens Schröter (mit Prof. Anja Stöffler, Hochschule Mainz): "Van Gogh TV. Erschließung, Multimedia-Dokumentation und Analyse ihres Nachlasses", DFG (2018-2021).
- PD Dr. Christoph Ernst: "Internationales Netzwerk Medienphilosophie", übernommen von Dr. Katerina Krtilova, Universität Weimar, DFG (2018-2020).
- Dr. Till A. Heilmann: "Das prozessierte Bild. Bildverarbeitung im Zeitalter von Photoshop", DFG Eigene Stelle im Rahmen des SPP 2172 "Das digitale Bild" (2020, danach weitergeführt an der Ruhr-Universität Bochum).
- Prof. Dr. Britta Hartmann (zusammen mit Dr. Christian Tedjasukmana und Prof. Dr. Jens Eder): "Bewegungs-Bilder 2.0 – Videoaktivismus zwischen Social Media und Social Movements", VW-Stiftung Planning Grant (2016-2018).
- Prof. Dr. Jens Schröter (zusammen mit Dr. Stefan Meretz, Dr. Hanno Pahl, Dr. Manuel Scholz-Wäckerle): "Die Gesellschaft nach dem Geld. Eröffnung eines Dialogs", VW-Stiftung (2016-2018).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "Deliberation im Netz: Formen und Funktionen des digitalen Diskurses am Beispiel des Microbloggingsystems Twitter", DFG SPP 1505 (gefördert über die gesamte SPP-Laufzeit, 2010-2016).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "Twitter im EU-Wahlkampf: Ein Vergleich der Twitterkommunikation deutscher und französischer Kandidaten und Kandidatinnen im Europawahlkampf 2014", DAAD (2014-2015).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "Erregungskampagnen in Politik und Wirtschaft -Digitale Öffentlichkeit zwischen Candy- und Shitstorms", BAPP-Projekt (2013-2014).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "Women and the Media in European Union" (Frauen und Medien in der Europäischen Union – Partizipation und Repräsentation“, EU EIGE (2012-2013).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "China im Spiegel der deutschen Gesellschaft", BAPP-Projekt (2012-2013).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "#Gehwählen – Der Bundestagswahlkampf 2013 auf Twitter", BAPP-Projekt (2011-2012).
- Prof. Dr. Caja Thimm: "Digitale Citoyens – Politische Partizipation im Zeichen von Social Media", BAPP-Projekt (2011-2012).

Projektionen des nächsten Menschen
Curstädt, L. (2025). Projektionen des nächsten Menschen. Post- und Transhumanismus in Spielfilmen des 21. Jahrhunderts. Büchner Verlag.
Für Ray Kurzweil, Googles technischen Entwicklungsleiter, ist die Lage klar: Das 21. Jahrhundert ist das des Posthumanismus. Nicht mehr lange und schon ist die Imagination vom optimierten ›neuen Menschen‹ nicht mehr nur Topos der Kunst-, Kultur- und Filmgeschichte, sondern Wirklichkeit. Für viele mag dies bizarr, für manche abwegig klingen und in der Tat ist ›der nächste Mensch‹ noch nicht Realität, seine Projektion aber ragt längst, angetrieben durch die finanzstarke Unterstützung des Silicon Valleys, in unser Hier und Jetzt hinein. Die große Frage lautet: Welche Rolle nimmt hierin der SciFi-Film ein? Ist er nachahmender, weil längst abgehängter Weggefährte einer sich rasant entwickelnden, realen Techno-Utopie?
Lucas Curstädt hält in seiner Studie dagegen: Ausgehend von der These, dass das Abhängigkeitsverhältnis ein umgekehrtes ist, da das Technik-Labor ideengeschichtlich, ästhetisch und erkenntnistheoretisch vom Kino-Labor abhängig bleibt, legt er aus ideologiekritischer Perspektive dar, wie Hollywood im 21. Jahrhundert sich in seinen Filmen zum Silicon Valley positioniert. Und dann ist da noch eine andere, tiefgreifende Veränderung: Was hat es mit jenen ›posthumanen Agenten‹ auf sich, die immer stärker die Leinwände des Kinos bevölkern und bereits verstorbene Schauspieler_innen neu zum Leben erwecken?
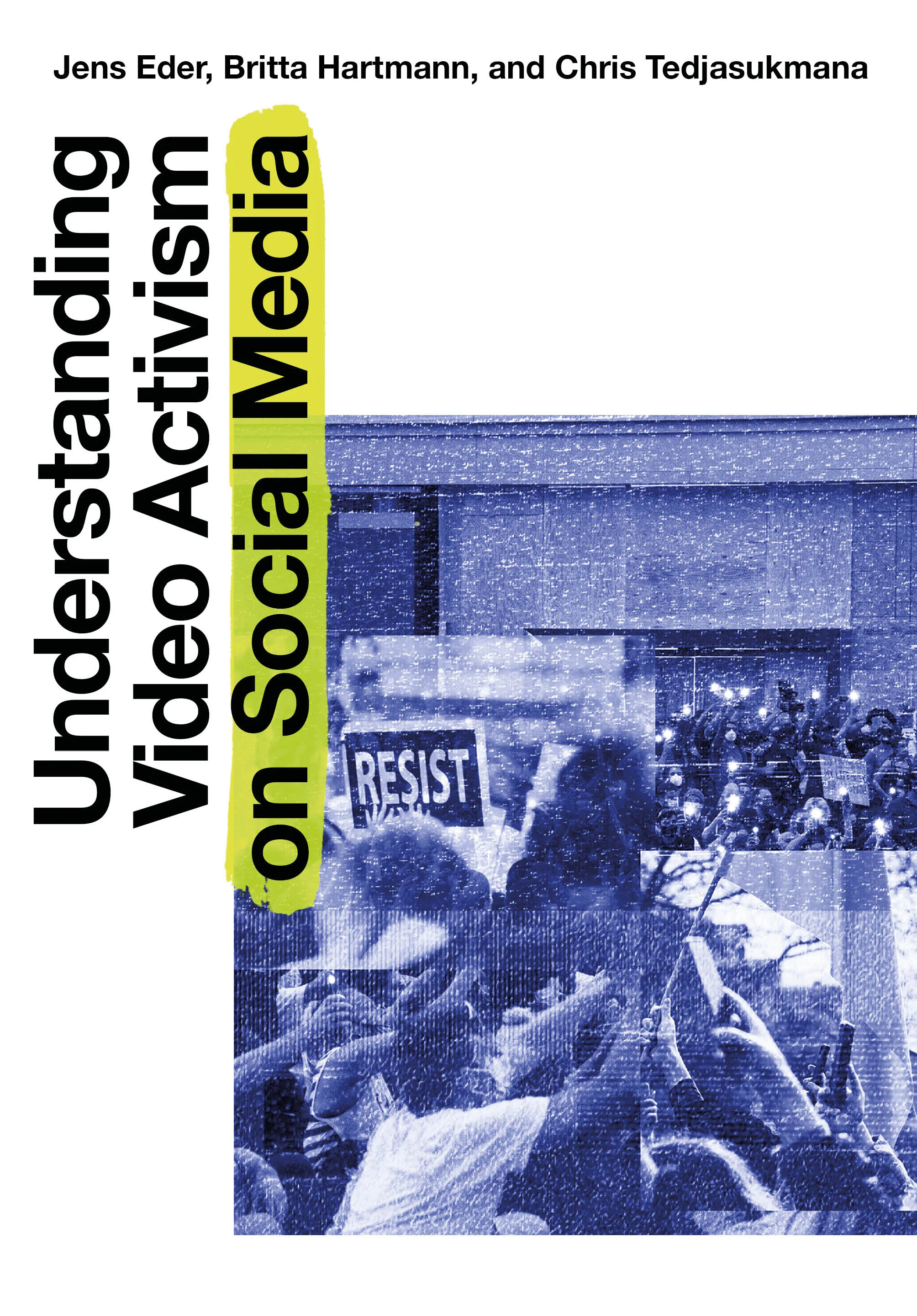
Understanding Video Activism on Social Media
Eder, J., Hartmann, B., & Tedjasukmana, C. (2025). Understanding Video Activism on Social Media. Intellect Books.
What political power do videos on social media have? In what ways do they exert influence, shape publics and change political life? And how can committed civil society actors in this field assert themselves against hegemonic discourses, commercial interests, anti-democratic agitation, and authoritarian propaganda? These questions are being debated intensely as social media increasingly dominate global information flows, and videos increasingly dominate social media.
Understanding video activism seems particularly relevant at a time when the internet is undergoing fundamental disruptions. The forms, practices, and opportunities of activism depend on its media environment, which now is changing rapidly and profoundly in terms of its technological basis, ownership, legal regulations, and governmental control.
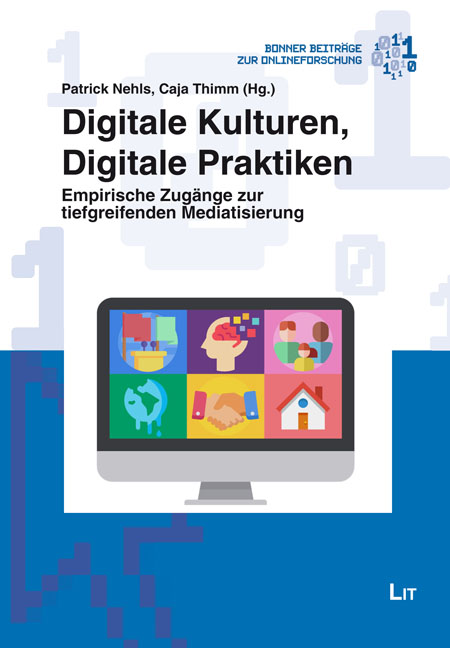
Digitale Kulturen, Digitale Praktiken
Thimm, Caja, Nehls, Patrick (Hg.) (2023). Digitale Kulturen, Digitale Praktiken, Münster: LIT-Verlag
Einflüsse der tiefgreifenden Mediatisierung lassen sich in nahezu allen Lebensbereichen nachvollziehen und reflektieren einen grundlegenden Wandel des sozialen, kulturellen und politischen Alltags durch digitale Medien. Der vorliegende Band bündelt ausgewählte Perspektiven und Kontexte, die mithilfe unterschiedlicher methodischer Verfahren exploriert wurden. Gegenstandsbereiche sind u. a. Familie, Politik oder Klimawandel. Zur Anwendung kommen dabei diverse empirische Zugänge, die im Hinblick auf ihre Passfähigkeit für die Erforschung digitaler Medienpraktiken geprüft werden.
Das Buch auf der Verlagswebseite (LIT)
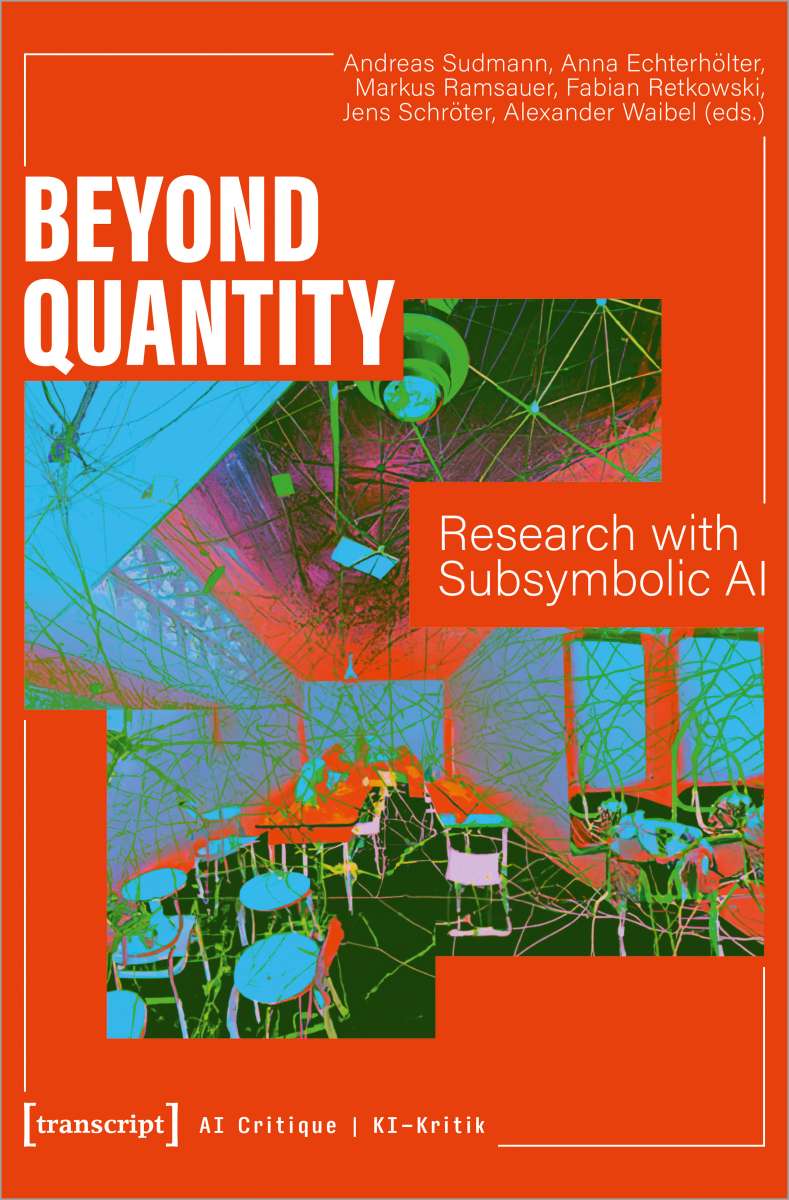
Beyond Quantity: Research with Subsymbolic AI
Sudmann, A., Echterhölter, A., Ramsauer, M., Retkowski, F., Schröter, J., & Waibel, A. (Eds.). (2023). Beyond Quantity: Research with Subsymbolic AI (Vol. 6). transcript Verlag.
How do artificial neural networks and other forms of artificial intelligence interfere with methods and practices in the sciences? Which interdisciplinary epistemological challenges arise when we think about the use of AI beyond its dependency on big data? Not only the natural sciences, but also the social sciences and the humanities seem to be increasingly affected by current approaches of subsymbolic AI, which master problems of quality (fuzziness, uncertainty) in a hitherto unknown way. But what are the conditions, implications, and effects of these (potential) epistemic transformations and how must research on AI be configured to address them adequately?
Website of the publisher (transcript)
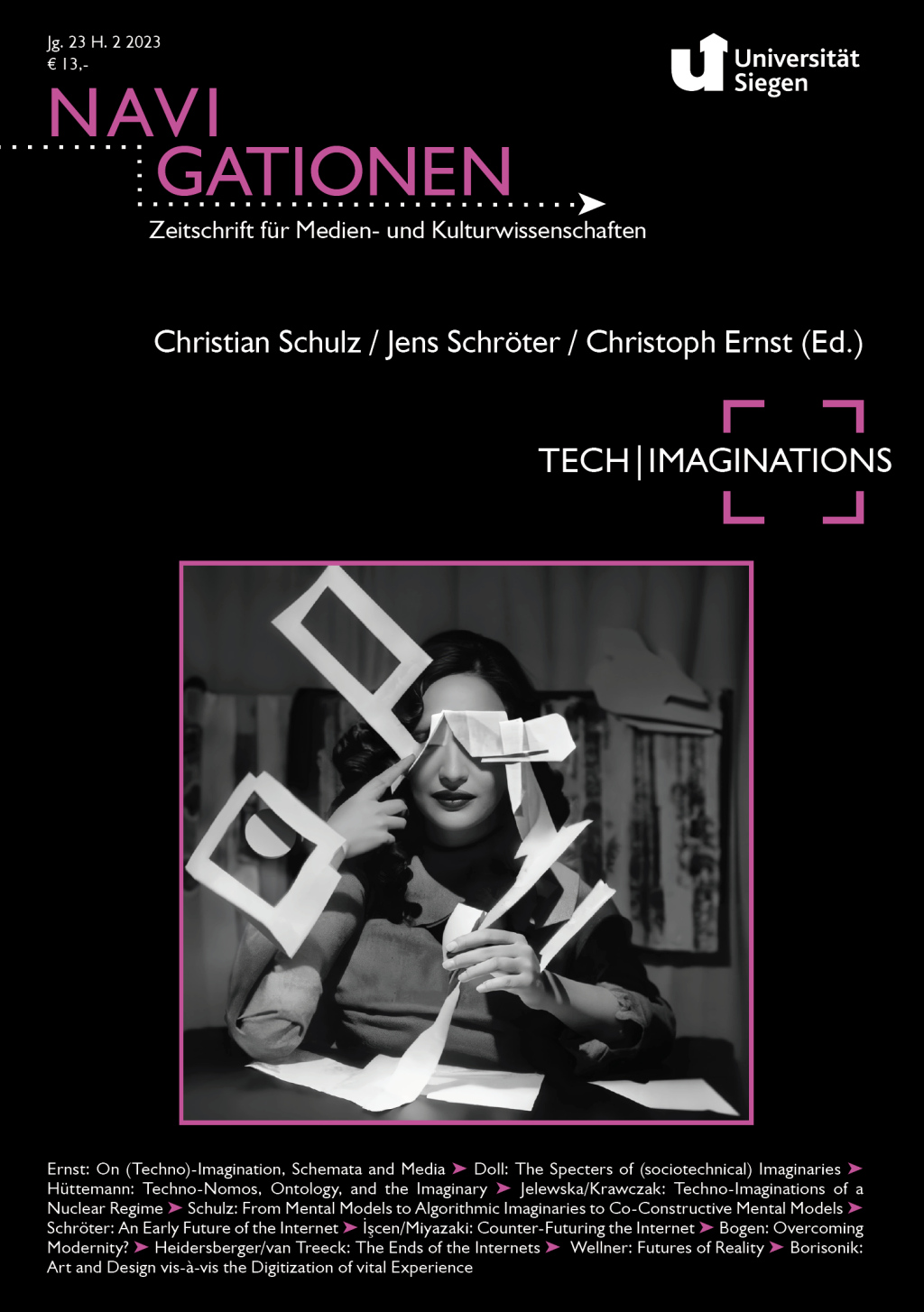
Navigationen: Tech | Imaginations
Navigationen, Heft 2/23, herausgegeben von Christian Schulz, Jens Schröter und Christoph Ernst
Technologies and especially media technologies are pervasive in modern societies. But even more omnipresent are the imaginaries of modern technologies – what technologies are thought to be capable of or what effects they are supposed to have. These imaginations reveal a lot of the political and ideological self-descriptions of societies, hence the (techno-)imaginary also functions as a kind of epistemic tool.
Concepts of the imaginary therefore have experienced an increasing attention in cultural theory and the social sciences in recent years. In particular, work from political philosophy, but also approaches from science and technology studies (STS) or communication and media studies are worth mentioning here. The term "techno-imagination", coined by Vilém Flusser in the early 1990s, refers to the close interconnection of (digital) media and imaginations, whose coupling can not only be understood as a driver of future technology via fictional discourses (e.g. science fiction), but much more fundamentally also as a constitutive element of society and sociality itself, as Castoriadis has argued.
In the first part of the issue several theoretical contributions add new aspects to the discussion of socio-technical imaginaries, while in the second part a workshop held in January 2022 at the CAIS in Bochum is documented, in which the case of the imaginaries of “Future Internets” was discussed.
Publishing announcement at the website of Prof. Dr. Jens Schröter
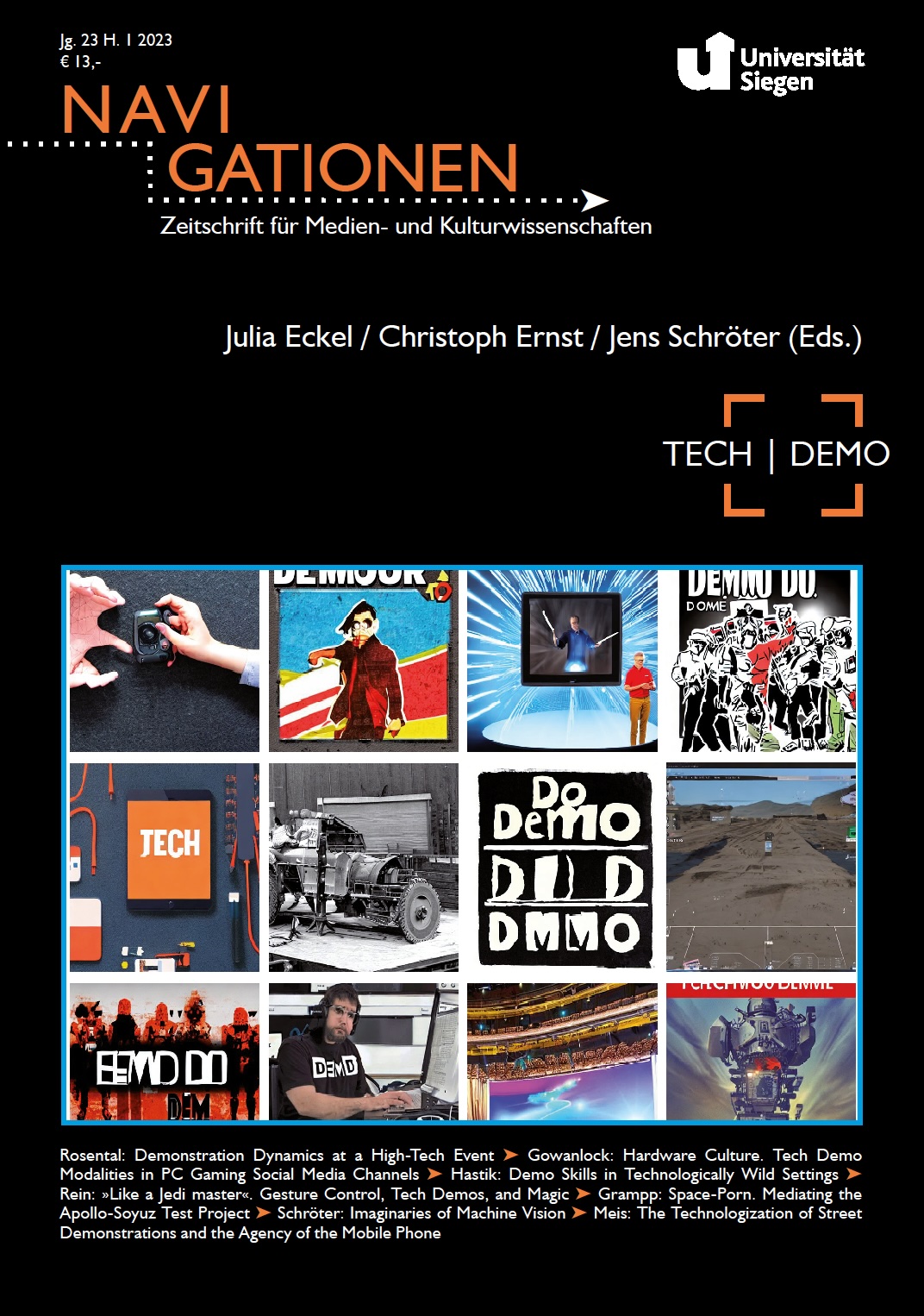
Navigationen: Tech | Demo
Navigationen, Heft 1/23, herausgegeben von Julia Eckel, Christoph Ernst und Jens Schröter
On the one hand, the volume focusses on technology demonstrations as cultural and instrumental practices in the contexts of technology- and media-development. On the other hand, the contributions highlight the technologization of demonstrations regarding the reliance of (political) demonstrations on media technologies. Building on this nexus, demonstrations appear as mediahistorically and -theoretically significant sites that reveal and negogiate intersections of technology, individual, and society, politics, performance, and aesthetics, as well as human and technical scopes of agency.
Link to the full text (UB Siegen)
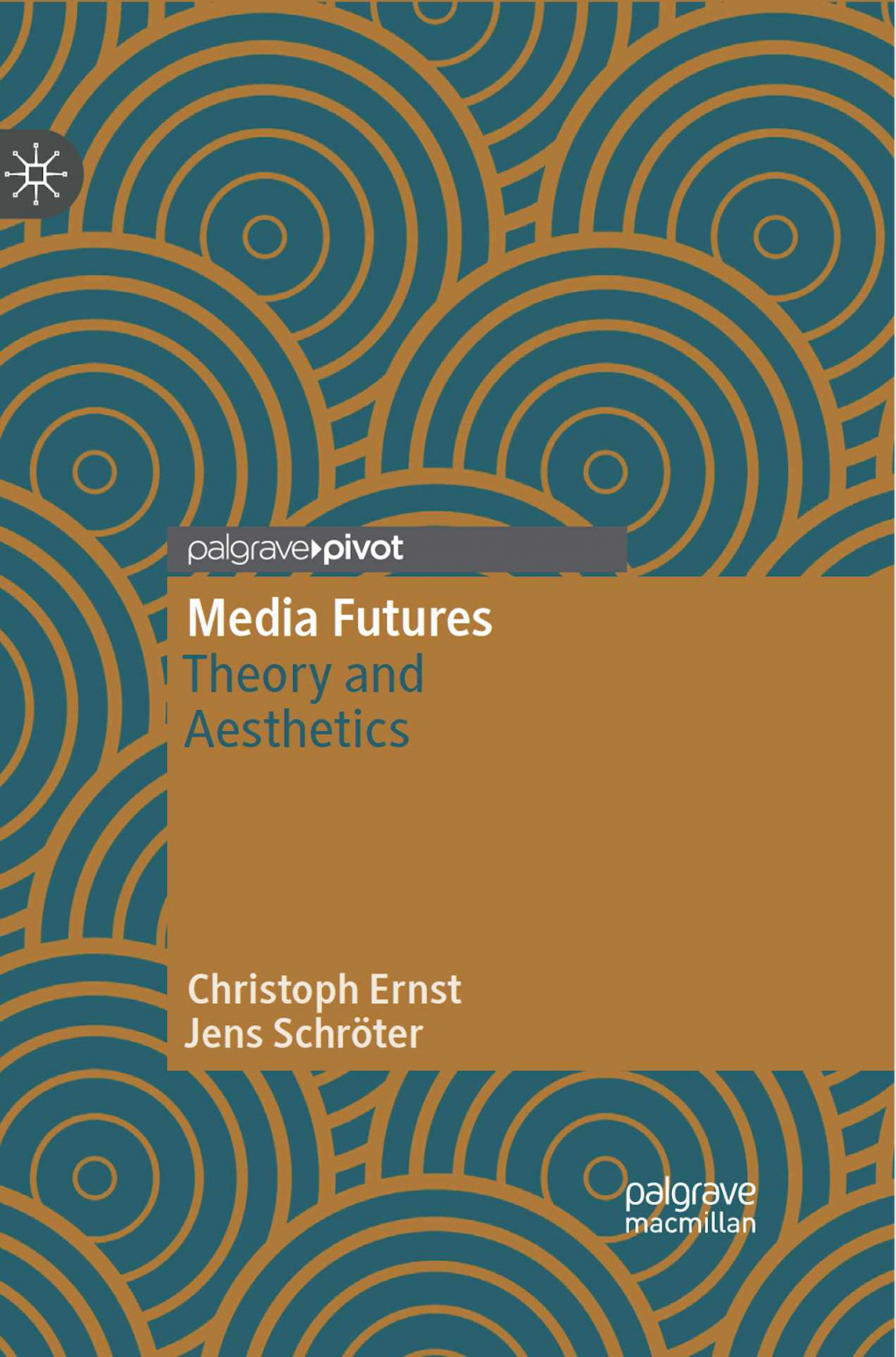
Media Futures. Theory and Aesthetics
Neues Buch von PD Dr. Christoph Ernst und Prof. Dr. Jens Schröter in UK und den USA erschienen: MEDIA FUTURES!
This book deals with the connection between media and the future. It is about the imagination of futuristic media and what this says about the present, but it also shows how media are imagined as means to control the future. The book begins by describing different theories of the evolution of media and by exploring how this evolution is tied to expectations regarding the future. The authors discuss the theories of imagination and how the imagination of media futures operates. To do so, they analyse four concrete examples: the imaginations once related to interactive television and how they were performed in an important piece of media art; those on “ubiquitous computing,” which remain present today; those on three-dimensional, especially holographic, displays that are prevalent everywhere in cinema, and lastly the contemporary imaginations on quantum computing and how they have been enacted in science fiction. The book appeals to readers interested in the question of how our present imagines its technological futures.
Christoph Ernst is Associate Professor for Media Studies at the University of Bonn, Germany. His main research interests are information visualization, interface studies, media theory, and future studies.
Jens Schröter is Chair for Media Studies at the University of Bonn. His main research interests are digital media, future studies, and critical media studies.
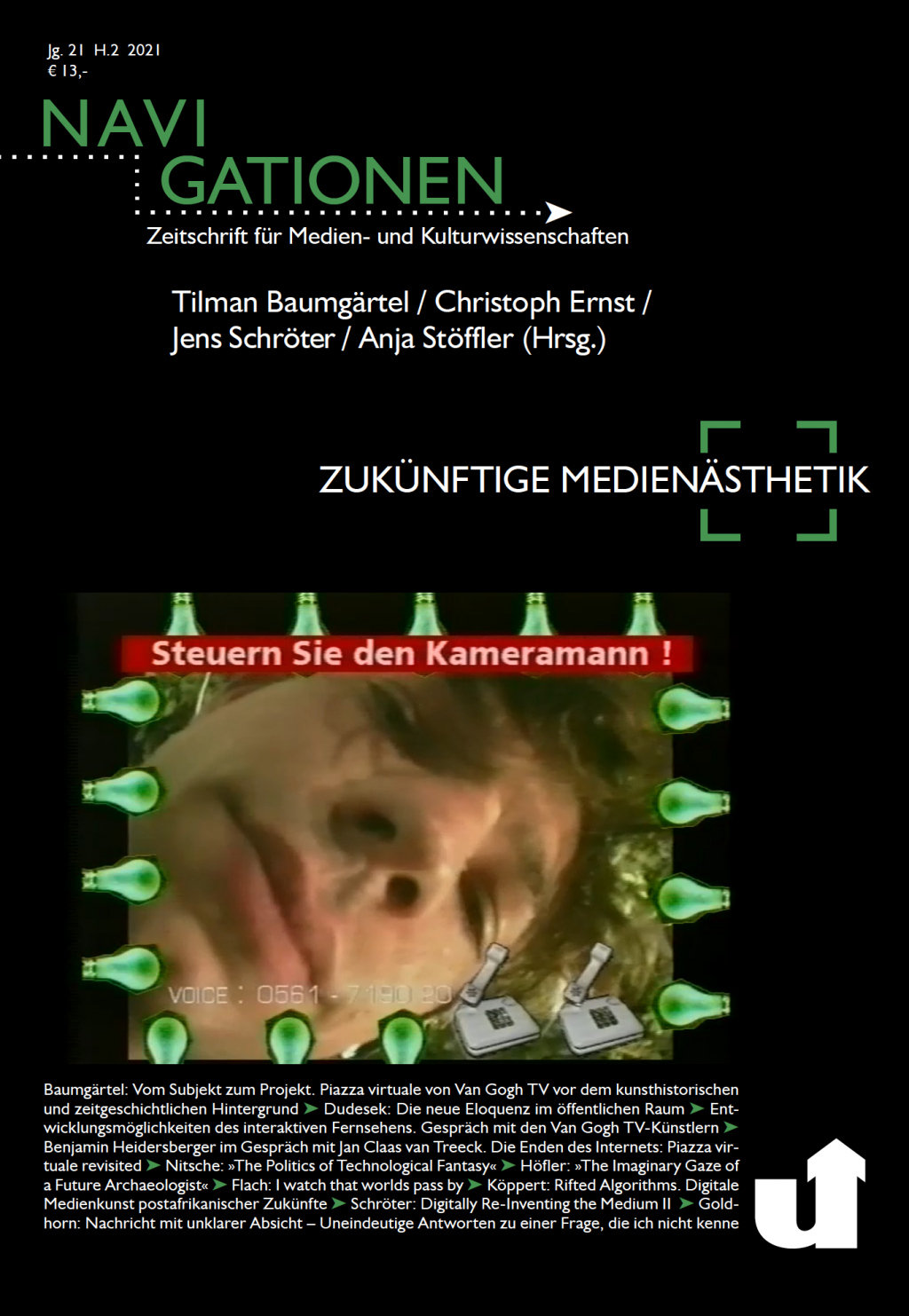
Navigationen: Zukünftige Medienästhetik
Herausgegeben von Prof Dr. Jens Schröter, Prof. Dr. Tilman Baumgärtel, PD Dr. Christoph Ernst und Prof. Anja Stöffler
OUT NOW!
Navigationen 2/2021: Zukünftige Medienästhetik, hrsg. von Jens Schröter, Tilman Baumgärtel, Christoph Ernst und Anja Stöffler.
Die ab Heft 1/2015 von Prof. Dr. Jens Schröter als Hauptherausgeber zusammen mit dem Graduiertenkolleg Locating Media (Universität Siegen) und Prof. Dr. Benjamin Beil (Universität zu Köln) herausgegebene kultur- und medienwissenschaftliche Zeitschrift Navigationen widmet sich in ihrer aktuellen Ausgabe (2/2021) dem Thema Zukünftige Medienästhetik.
Eine zukünftige Medienästhetik ist sowohl eine Medienästhetik der Zukunft, als auch eine Ästhetik zukünftiger Medien. Medienkunst hat schon immer ungedachte und unversuchte Möglichkeiten verschiedenster Medien ausprobiert und damit einen imaginativen Vorschein zukünftiger Medien erzeugt. Medienkunst, eine der zentralen Kunstformen des 20. und 21. Jhds., sah es als eine ihrer Aufgaben an, neue Medien zu erfinden (Rosalind Krauss) – oft gerade im Rückgriff auf obsolet wirkende Technologien und Verfahren. Medienkunst reflektiert also nicht bloß ein zugrundeliegendes Medium, wie es von der (hoch-)modernistischen Ästhetik und problematisch genug, für alle Kunst behauptet wurde. Sie erfindet erst ein Medium. Medien sind dabei von Imaginationen umgeben, die ihrer Erfindung vorhergehen, ihre Durchsetzung begleitet und in ihrem Verschwinden nostalgisch nachklingen. Medienkunst kann deshalb als ein spezieller Fall solcher Imaginationen verstanden werden – eine Imagination, die nicht (nur) diskursiv, sondern materiell, demonstrativ und performativ aufgeführt wird. In dem Heft sind Beiträge versammelt, die die Praktiken der Erfindung zukünftiger Medien durch die Medienkunst untersuchen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem wichtigen medienkünstlerischen Projekt Piazza virtuale von Van Gogh TV, welches auf der documenta IX 1992, genau am Vorabend der Ausbreitung des Internets, das zukünftige Medium eines interaktiven Fernsehens entwarf.
A future media aesthetic is both a media aesthetic of the future and an aesthetic of future media. Media art has always explored unimagined and untried possibilities of various media, creating an imaginative glimpse of future media. Media art, one of the central art forms of the 20th and 21st centuries, saw it as one of its tasks to invent new media (Rosalind Krauss) - often precisely by resorting to technologies and processes that seem obsolete. Media art, then, does not merely reflect an underlying medium, as was claimed by (high) modernist aesthetics, and problematically enough, for all art. It first invents a medium. Media are thereby surrounded by imaginaries that precede their invention, accompany their enforcement, and resonate nostalgically in their disappearance. Media art can therefore be understood as a special case of such imaginaries - an imagination that is not (only) discursive, but material, demonstrative and performative. The issue gathers contributions that examine the practices of inventing future media through media art. One focus is on the important media art project Piazza virtuale by Van Gogh TV, which conceived the future medium of an interactive television at documenta IX in 1992, precisely on the eve of the spread of the Internet.

Bewegungsbilder: Politische Videos in Sozialen Medien
Videos im Social Web haben sich zu mächtigen Mitteln der politischen Auseinandersetzung um Menschenrechte, Migration, Umweltzerstörung oder Kriegsverbrechen entwickelt. Von Kampagnenvideos über Zeugenvideos zu Videoblogs und Mashups – aktivistische Webvideos verbreiten sich in digitalen Netzwerken und bringen affektive Öffentlichkeiten hervor. Doch mit dem Aufstieg von Lügen, Propaganda und Hetze im Social Web entbrennt zugleich ein globaler »Krieg der Bilder«. Trägt die neue Macht bewegter Bilder letztlich zur Ermächtigung oder zur Ohnmacht der politischen Subjekte bei? Welche neuartigen ästhetischen, affektiven und narrativen Formen bilden die politischen Bewegungsbilder heraus? Wie beeinflussen sie die politische Praxis? Führen Strategien der Emotionalisierung zu konformistischem Politikkonsum? Wie wird Verifizierung ermöglicht oder Authentizität vorgetäuscht? Haben wir es mit einer benutzerfreundlichen Partizipationsform für aufgeklärte »Netizens« zu tun? Oder verlaufen sich die neuen Bewegungsbilder in folgenlosem »Klicktivismus«? Das Buch gibt erstmals eine Übersicht über politische Bewegungsbilder im Social Web. Anhand zahlreicher Beispiele analysiert es klarsichtig die Vielfalt aktivistischer Webvideos, ihre Typen und Themen, ihre ästhetischen und rhetorischen Strategien, ihre affektiven Wirkungspotenziale und transmedialen Bezüge, ihre historischen Vorbilder und ihre Produktionskontexte. Jenseits von Technikskepsis und Politikverdrossenheit plädiert das Buch für die kreative Macht der Zivilgesellschaft und die Lust am politischen Handeln.

Navigationen: Neue Rechte und Universität
Prof. Dr. Jens Schröter als Hauptherausgeber zusammen mit dem Graduiertenkolleg "Locating Media" (Universität Siegen) und JProf. Benjamin Beil:
AG Siegen Denken (Hg.): Neue Rechte und Universität
In dieser Ausgabe der "Navigationen" sammeln wir Ressourcen gegen die Vereinnahmung der Universität durch die so genannte Neue Rechte. Auslöser für das Themenheft sind die Geschehnisse rund um ein Seminar, das im Wintersemester 2018/19 unter dem Titel „Denken und Denken lassen. Zur Philosophie und Praxis der Meinungsfreiheit“ an der Universität Siegen angeboten wurde.
Das Seminar wurde von einer Vorlesungsreihe flankiert, in der „dezidiert konservative oder rechte Denker“ eine Bühne bekamen, u.a. Marc Jongen von der AfD, und der Autor Thilo Sarrazin. Ein zentrales Anliegen dieser Ausgabe ist es, die Siegener Ereignisse zu dokumentieren, wissenschaftlich aufzuarbeiten und in verschiedenen Hinsichten zu kontextualisieren: diskursstrategisch, geographisch, historisch und politisch. Hierzu versammelt das Heft Beiträge diverser Forschungsdisziplinen – explizit auch von Vertreter*innen derjenigen Disziplinen, deren Existenzrecht von Teilen der Siegener Vortragenden in Zweifel gezogen wird. Um die Diversität der betroffenen Zugänge zu repräsentieren, sind über die Medienwissenschaft hinaus Beiträge aus der Islamwissenschaft, den Gender Studies, der Linguistik und der Soziologie im Heft vertreten.
Link zum Volltext (UB Siegen)
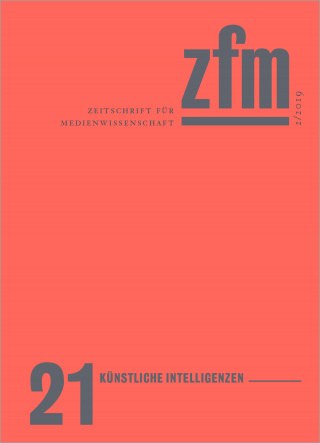
Zeitschrift für Medienwissenschaft 21: Künstliche Intelligenzen
Zeitschrift für Medienwissenschaft 21, Schwerpunkt hrsg. von Christoph Ernst, Irina Kaldrack, Jens Schröter, Andreas Sudmann zu: Künstliche Intelligenzen!
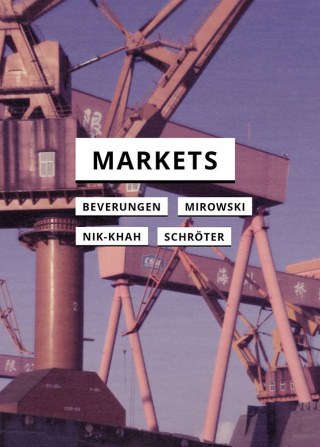
Markets: In Search of Media
Armin Beverungen, Philip Mirowski, Edward Nik-Khah, Jens Schröter, meson press, 2019.
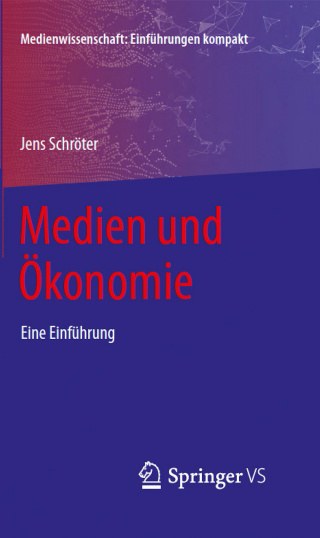
Medien und Ökonomie
Jens Schröter
Der Band führt in die Literatur zu den verschiedenen Aspekten des Verhältnisses von Medien und Ökonomie ein.
Schröter, Jens. Medien und Ökonomie: Eine Einführung. Springer-Verlag, 2019.
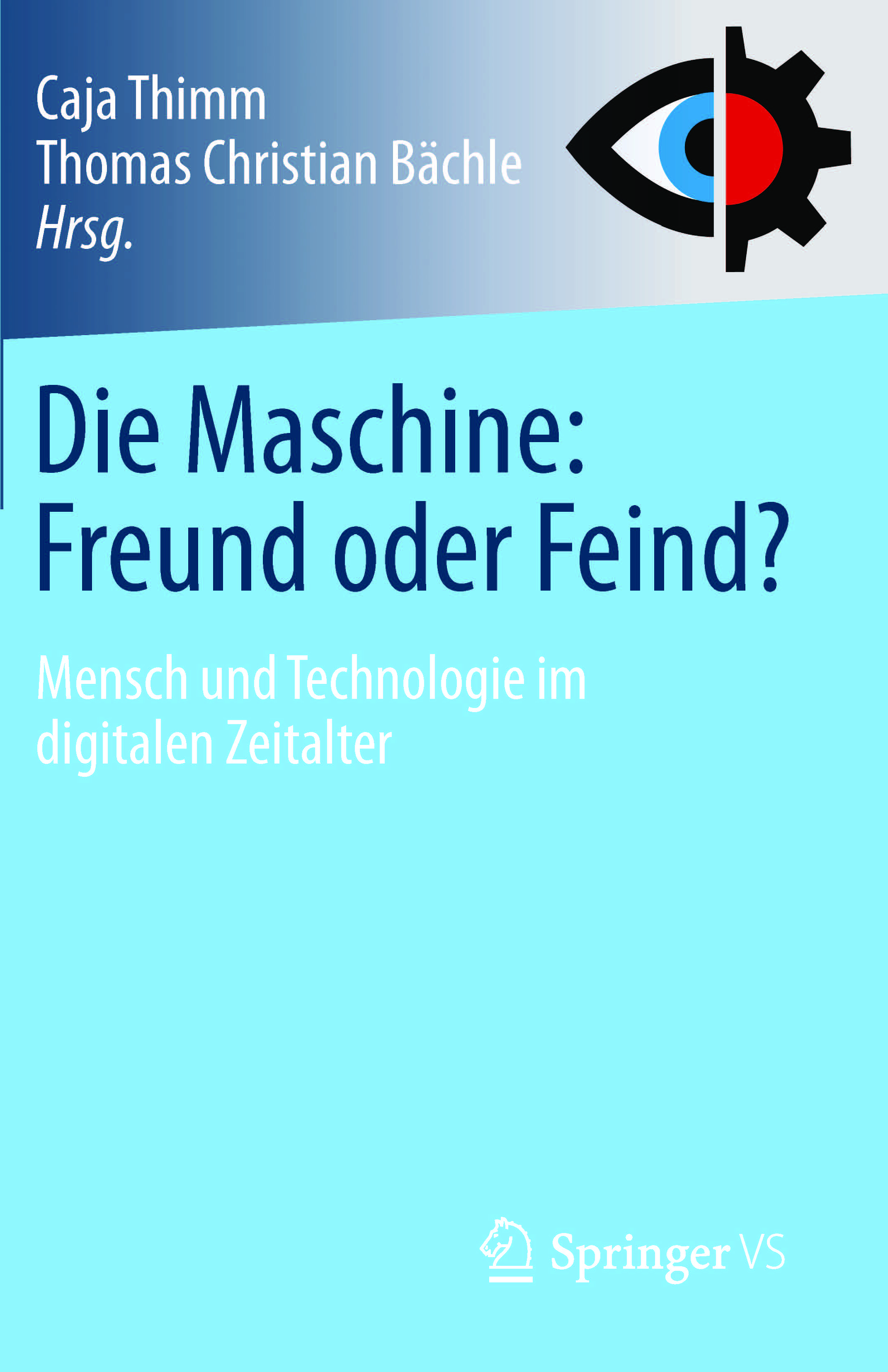
Die Maschine: Freund oder Feind
Die Maschine: Freund oder Feind. Mensch und Technologie im digitalen Zeitalter.
Thimm, Caja, and Thomas Christian Bächle, eds. Die Maschine: Freund oder Feind?: Mensch und Technologie im digitalen Zeitalter. Springer-Verlag, 2019.
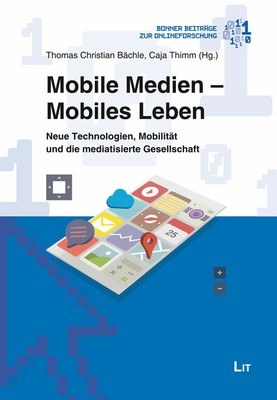
Mobile Medien – Mobiles Leben
Bächle, Thomas Christian / Thimm, Caja (Hg.)
Mobile Medien – Mobiles Leben
Neue Technologien, Mobilität und die mediatisierte Gesellschaft
Reihe: Bonner Beiträge zur Onlineforschung
Bd. 3, 2014, 280 S., 19.90 EUR, br., ISBN 978-3-643-11604-8
Mobile Medien verändern unser Leben grundlegend – sie lassen uns soziale Beziehungen anders erleben oder Orte neu wahrnehmen. Sie transformieren gleichzeitig die Rhythmen und Rituale unseres zunehmend mediatisierten Alltags. Die ubiquitäre Nutzung von mobilen Medien birgt dabei sowohl erhebliche infrastrukturelle, soziale und wirtschaftliche Chancen als auch vielfältige Risiken. Vertreterinnen und Vertreter der Geographie, der Informatik, der Medienwissenschaft und der Soziologie bieten in diesem Band einen Blick darauf, wie mobiles Leben transdisziplinär perspektiviert werden kann.
Alle Publikationen
Die Veränderungen der medialen Umwelten, die rasanten technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Medienkommunikation und insbesondere die Herausforderung durch die neuen elektronischen Medien, namentlich das Internet, haben in den letzten Jahren zu einer Ausweitung der Fragestellungen im Bereich der Medienforschung geführt und – konsequenterweise – zu einer stärkeren Verankerung der Medienwissenschaften an den Hochschulen.
Was genau der Gegenstandsbereich und die theoretischen Grundlagen der Medienwissenschaft sind, ist dabei genauso in die Diskussion geraten wie die disziplinär bedingten Schwerpunkte und Methoden. Die Medienwissenschaft ist eine Disziplin, die sich mit dem Entwurf grundlagenorientierter Theorien und Konzepte und der Beschreibung und Erklärung der umfassenden Wandlungsprozesse und Wirkungszusammenhänge ebenso zu beschäftigen hat wie mit der Analyse des Kanons der Formensprachen von Text, Bild und Ton.
Die in der Reihe „Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft (BBM)“ erscheinenden Bände umfassen nicht nur Einzel- und Fallanalysen, sondern auch Fragen von Medientheorie, Begriffsbildung, Formen, Bedeutungen und Folgen der Mediennutzung und der Medienpräsenz in der Gesellschaft. Neben den damit zusammenhängenden allgemeineren Themenbereichen soll die Reihe „BBM“ besonders den in Bonn vertretenen Schwerpunkten ein Forum verschaffen, wozu in herausragender Rolle die sprachliche Kommunikation gehört. Themen beinhalten hier individuelle und gesellschaftliche Wahrnehmungsweisen von Sprachgebrauch in den Medien sowie kommunikative Verfahren und Muster, die in der Medienkommunikation eine Rolle spielen.

Band 1: Unternehmenskommunikation offline/online
Thimm, Caja (Hrsg.):
Unternehmenskommunikation offline/online
Wandelprozesse interner und externer Kommunikation durch neue Medien
Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2002. IV, 313 S., ISBN 978-3-631-36627-1 br.
Der Sammelband greift wichtige Kommunikationsformen von Unternehmen und Organisationen auf und verdeutlicht die medial bedingten Wandelprozesse und Gebrauchsformen. Im ersten Teil werden solche Textsorten berücksichtigt, die sich herkömmlicher, offline-basierter Mündlichkeits und Schriftlichkeitsformen bedienen, so zum Beispiel Geschäftsberichte oder Teamsitzungen. Im zweiten Teil des Bandes werden Textsorten in ihrer netzvermittelten Form dargestellt, sodass aus der Gesamtschau des Bandes ersichtlich wird, welche Prozesse durch den technologischen Wandel im Bereich der Unternehmenskommunikation ausgelöst werden. Behandelt werden Online-Textformen wie Online-Werbung, Gästebücher oder Unternehmenssites. Dabei werden nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch Organisationen wie Universitäten, Städte und Kirchen in die Untersuchungen einbezogen.

Band 2: Medienwissenschaft
Lenders, Winfried (Hrsg.)
Medienwissenschaft
Eine Herausforderung für die Geisteswissenschaften
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004. 224 S., ISBN 978-3-631-51226-5 br.
An zahlreichen deutschen Universitäten sind in den letzten Jahren Studiengänge mit der Bezeichnung «Medienwissenschaft» entstanden. Man will damit der Tatsache Rechnung tragen, dass die Entwicklung der Medien in allen Wissenschaften und in den korrespondierenden Berufsfeldern einen tiefgreifenden Wandel bewirkt hat. Dieser Sammelband spiegelt wider, wie durch die Einrichtung des Bonner Studiengangs «Medienwissenschaft» dieser Herausforderung begegnet worden ist. Er erhebt darüber hinaus den Anspruch, zentrale Gegenstände und Methoden einer modernen geisteswissenschaftlichen Medienwissenschaft zu beschreiben.
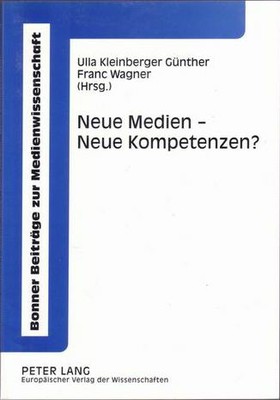
Band 3: Neue Medien – Neue Kompetenzen?
Kleinberger Günther, Ulla / Wagner, Franc (Hrsg.)
Neue Medien – Neue Kompetenzen?
Texte produzieren und rezipieren im Zeitalter digitaler Medien
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004. 224 S., ISBN 978-3-631-51160-2 br.
Kleinberger Günther, Ulla / Wagner, Franc (Hrsg.)
Neue Medien – Neue Kompetenzen?
Texte produzieren und rezipieren im Zeitalter digitaler Medien
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004. 224 S., ISBN 978-3-631-51160-2 br.
Mehr zum Titel
Der Einfluss neuer Medien im beruflichen und privaten Alltag wächst beständig. Texte produzieren und rezipieren im Zeitalter digitaler Medien stellt Anforderungen ganz unterschiedlicher Art an die Nutzerinnen und Nutzer. Die zentrale Fragestellung ist, inwieweit dazu neue Kompetenzen erforderlich sind oder ob die bisherigen erweitert werden müssen. Hier schliesst sich die Frage an, welche Kompetenzen verstärkt unterrichtet und wie sie vermittelt werden müssen. Die Beiträge gehen das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven an, wie zum Beispiel der Textlinguistik, der Mediensoziologie und der Pädagogik.

Band 4: Mediendiskurse
Fraas, Claudia / Klemm, Michael (Hrsg.)
Mediendiskurse
Bestandsaufnahme und Perspektiven
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2005. VI, 370 S., ISBN 978-3-631-53421-2 br.
Die Beiträge des Bandes nehmen aus unterschiedlichen Perspektiven den Zusammenhang von gesellschaftlichem Wissen und (massen)medialen Diskursen in den Blick und machen deutlich, dass die an Foucault orientierte linguistische Diskursforschung ihren Kinderschuhen inzwischen entwachsen ist. Der Band dokumentiert den Status quo und zeigt Perspektiven auf, die sich für eine Weiterentwicklung der text- und medienlinguistischen Diskursanalyse eröffnen: erstens die theoretisch-methodische Fundierung und Präzisierung relevanter Begriffe und geeigneter Instrumentarien, zweitens die Einbeziehung Neuer Medien und nonverbaler Zeichenformen (z.B. Bilder). Die empirischen Analysen beziehen sich auf aktuelle oder historische Diskurse, unter anderem zum 11. September 2001 und zum Irak-Krieg, zur Wehrmachtsausstellung, zur Asyldebatte, zum Mediendiskurs der DDR und zur Diskussion um die Rechtschreibreform.

Band 5: Netz-Bildung
Thimm, Caja (Hrsg.)
Netz-Bildung
Lehren und Lernen mit neuen Medien in Wissenschaft und Wirtschaft
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2005. 252 S., ISBN 978-3-631-52108-3 br.
Die Fortschritte in der Netzkommunikation haben zu einer intensiven Beschäftigung mit Fragen zur Zukunft von medienbasierter Bildung geführt. Häufig aber entsprechen die praktischen Konzepte nicht den Erfolgserwartungen, dies gilt für universitäre und für unternehmensbezogene Konzepte gleichermaßen. Konkrete fachbezogene Entwicklungen müssen vermehrt an individuelle Lernerpersönlichkeiten und spezifische Aufgaben angepasst werden. Immer wieder stellt sich die Frage, welche Lernkonzepte wir zugrunde legen und welche Formen des (kooperativen) Lernens wir erzielen wollen. Aus diesem Spannungsfeld greift der Sammelband ausgewählte Themen aus Wissenschaft und Wirtschaft auf. Dazu gehören u. a. webspezifische Usertypologien, Infographiken, aber auch konkrete Beispiele aus Lerngebieten wie der Statistik, der universitären Verwaltung, des Onlinejournalismus oder des medienbasierten Managements.

Band 6: Das Vergnügen in und an den Medien
Klemm, Michael / Jakobs, Eva-Maria (Hrsg.)
Das Vergnügen in und an den Medien
Interdisziplinäre Perspektiven
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2007. VI, 314 S., ISBN 978-3-631-56111-9 br.
Lange war die Unterhaltung ein Stiefkind der Medienforschung. Heute ist die Erforschung des medialen Vergnügens hoffähig geworden: von der Analyse der alltäglichen «Populärkultur» bis zur «neuen Witzischkeit» in Massenmedien. Während manche befürchten, dass wir uns «zu Tode amüsieren», halten andere entgegen, dass dem vergnüglichen Umgang mit Medieninhalten politische Subversion innewohnt. In diesem Band wird das Vergnügen in und an den Medien aus interdisziplinärer Perspektive (Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Soziologie, Psychologie) beschrieben. Das Spektrum reicht von Fernsehsendungen über Pressetexte und Comic-Strips bis hin zu neueren elektronischen Kommunikationsformen (Homepages, Chats), von Produktionsanalysen über die Analyse humorvoller Medieninhalte bis zum Vergnügen als Leistung der Mediennutzer (unter Zuschauern oder in Internetforen). Empirische Analysen werden flankiert von theoretischen Beiträgen zu den Phänomenen Humor, Unterhaltung, Vergnügen. Ziel ist es nicht allein, die Spielarten medialen Vergnügens aufzuzeigen; sondern auch die gesellschaftlichen und politischen Implikationen des Vergnügens in und an den Medien zu hinterfragen.

Band 7: Organisationskommunikation online
Thimm, Caja / Wehmeier, Stefan (Hrsg.)
Organisationskommunikation online
Grundlagen, Praxis, Empirie
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2008. 274 S., ISBN 978-3-631-56435-6 br.
Noch bis vor Kurzem als Tagungs-Langweiler verschrien, hat sich das Thema Online-Kommunikation im Zuge des Hypes um Web 2.0 wieder zu einem Renner entwickelt. Dieses Buch setzt sich mit Trends der Online-Organisationskommunikation auseinander, ohne sich vom Modebegriff Web 2.0 leiten oder gar vereinnahmen zu lassen. In den Analysen stehen soziale und technologische Herausforderungen im Vordergrund. Vor allem geht es um Leistungspotenziale und Risiken der digitalen Organisationskommunikation. Inwieweit steigert Online-Kommunikation die Funktionalität von Organisationen? Inwieweit kann sie selbst zum Problem werden? Diese Fragen werden theoretisch, praxisbezogen und empirisch unter anderem an den Phänomenen Weblogs, Unternehmensblogs, interne E-Mail-Kommunikation und Intranet bearbeitet.

Band 8: Visuelles Framing von Alter
Saskia Ziegelmaier
Visuelles Framing von Alter
Eine empirische Studie zur medialen Konstruktion von Alter
Frankfurt am Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009, ISBN 978-3-631-58646-4 .
Journalisten stehen bei der Berichterstattung über das Alter und Altsein vor einer besonderen Herausforderung: Es gilt, Tabuzonen wie Sterben und Tod alter Menschen ebenso zu visualisieren, wie ein glückliches Rentnerdasein oder Berichte über einen Generationenkonflikt. Aus wirkungstheoretischer Sicht kommt den Medien bei der Vermittlung von Altersvorstellungen eine wesentliche Rolle zu. Die Publikation setzt sich mit dem theoretischen Ansatz des Framings im Bildjournalismus auseinander und zeigt Forschungsperspektiven für einen Ansatz von visuellem Framing auf.
Die empirische Grundlage bildet eine Analyse von Altersdarstellungen in deutschen Nachrichtenmagazinen. Rezeptionsbegleitend wurde eine Studie mit alten und jungen Probanden durchgeführt. Dabei ließen sich unterschiedliche Muster für eine visuelle Rahmung von Alter identifizieren, die junge und alte Rezipienten jedoch vor dem Hintergrund ihres Selbst- und Fremdbildes deuten.
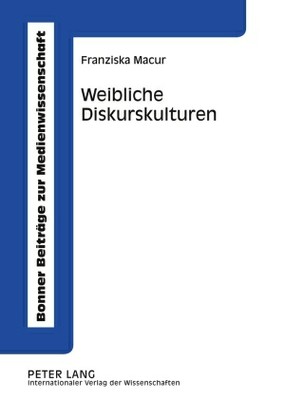
Band 9: Weibliche Diskurskulturen
Franziska Macur
Weibliche Diskurskulturen.
Privat. Beruflich. Medial
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009, ISBN: 9783631593233
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob rein weibliche Gruppen ein bestimmtes, wiederkehrendes kommunikatives Muster aufweisen und ob dieses vom Geschlecht oder von anderen Faktoren beeinflusst wird. Die Studie vergleicht verschiedene Frauengruppen miteinander, die einem unterschiedlichen Grad an Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Die Gespräche wurden nach der konversationsanalytischen Methode transkribiert und analysiert. Die Untersuchung zeigt, dass die Relevantsetzung von Geschlecht in der Interaktion weniger einflussreich ist, wohingegen kontextuelle Variablen einen starken Einfluss haben. Die Arbeit wurde betreut von Prof. Dr. Caja Thimm an der Universität Bonn.
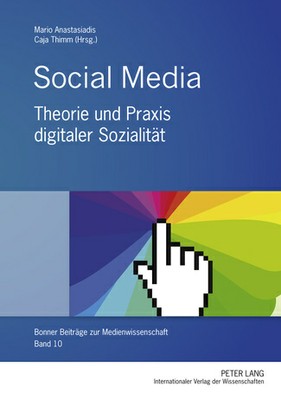
Band 10: Social Media
Anastasiadis, Mario / Thimm, Caja (Hrsg.)
Social Media
Theorie und Praxis digitaler Sozialität
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2011. 399 S., zahlr. Tab. und Graf.
ISBN 978-3-631-58685-3 geb. (Hardcover) ISBN 978-3-653-01083-1 (eBook)
Social Media-Applikationen sind eine zentrale Triebfeder von Online-Kommunikation. Sie organisieren und stützen soziale Kontakte, ermöglichen Arbeits-, Freundschafts- und Intimbeziehungen, versorgen Nutzerinnen und Nutzer mit Informationen aus allen Lebens-, Gesellschafts- und Politikbereichen, unterstützen Bürgerbewegungen, eröffnen neue Absatz- und Werbekanäle für Unternehmen und reorganisieren Wissen. In Social Communities, Blogs, Microblogging-Diensten, Video- und Musik-Plattformen etc., finden mediatisierte Formen sozialer Kommunikation einen ausdifferenzierten Ermöglichungsraum ineinander verschränkter Applikationen und Nutzungspraxen. Um sich der Relevanz von Social Media anzunähern, beleuchtet dieser Sammelband mit der Auffächerung in Theorieperspektiven, Social Media und Institution und Social Media und Nutzungskulturen drei Hauptschwerpunkte aktueller Social Media-Forschung.
Kontakt
Abteilung Medienwissenschaft
Geschäftszimmer
Dagmar Ogon
E-Mail: ogon@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-4746
Fax: +49 228 73-9287
Adresse
Lennéstraße 1
2. Etage, Raum 2.005
D - 53113 Bonn
Montag bis Donnerstag telefonisch erreichbar
Studiengangsmanagement
Claudia Wolf
E-Mail: clwolf@uni-bonn.de
Tel.: +49 228 73-54119
Adresse
Lennéstraße 6
3. Etage, Raum 3.033
D - 53113 Bonn